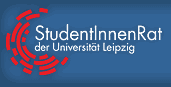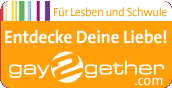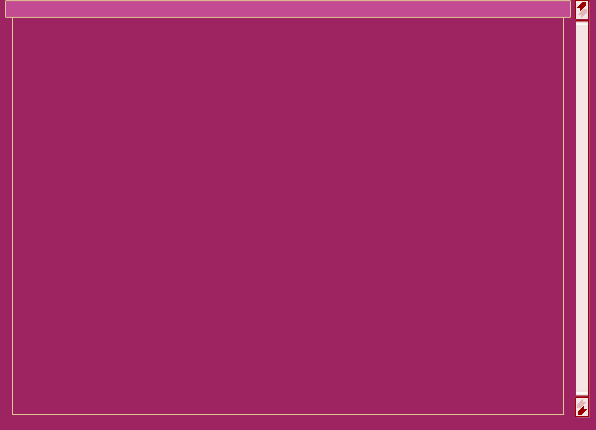


 [Unser Leipzig / Heldinnen Stadt]
[Unser Leipzig / Heldinnen Stadt]
Heldinnenstadt Leipzig
20. Jahrhundert
Hedwig Burgheim (1887-1943) studierte Pädagogik und Psychologie, welches seit 1911 an der ersten Frauen-Hochschule in Leipzig möglich war.1920 übernahm sie das Fröbel-Seminar in Gießen und erregte als Pädagogin großes Aufsehen. 1935 kehrt sie in ihre Heimatstadt Leipzig zurück, hielt hier wöchentliche Vorträge und Mütterseminare und half somit bei der Klärung von Erziehungsfragen. Sie baute eine jüdische Haushaltsschule auf, in der sich jüdische Mädchen aus ganz Deutschland auf ihre Ausreise vorbereiten sollten, um der Verfolgung zu entgehen. Sie arbeitete trotz erheblicher Einschränkungen getreu ihres Mottos "und dennoch" weiter, unterrichtet an der israelischen Carlebach-Schule und übernimmt den Vorsitz des Vereins "Israelitischer Kindergarten Tagesheim e.V." Am 17. Februar 1943 wird sie in Leipzig verhaftet und später im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Heute wird jährlich die Hedwig-Burgheim-Medaille für "Verdienste um Verständnis und Verständigung zwischen Menschen" verliehen.
Zwei Frauen, die für die Künstlerszene in Leipzig viel getan haben, sind Philippine Wolff-Arndt (1849-um 1933)
und Edith Mendelssohn Bartholdy. Beide schufen in Leipzig Künstlerinnenvereinigungen und
standen ihnen als erste vor.
Philippine Wolff-Arndt gründete zusammen mit Lotte Windscheid den Künstlerinnenverein
in Leipzig und war ihr Vorstand bis zu ihrem Wegzug 1920. Der Verein vermittelte Künstlerinnen
Arbeit und Ausstellungsmöglichkeiten und setzte sich für eine gediegene Ausbildung ein.
Edith Mendelssohn Bartholdy wurde 1930 Vorsitzende der GEDOK Ortsgruppe in Leipzig, die zu dieser
Zeit nach Hamburg und Hannover zu den größten Deutschlands zählte. Dieser Verein
existierte seit 1926 unter der Leitung von Ida Dehmel in Leipzig. 1933 wurden beide abgesetzt.
Edith Mendelssohn Bartholdy gründete ebenfalls Krippen und Säuglingspflegeheime in Leipzig,
arbeitete aber auch im Haus der Frau auf der BURGA "um der großen Frauensache Willen". In ihrem
Salon trafen sich Musiker und Künstler. Sie war ebenso Gründerin der Max-Reger-Gesellschaft
und ihre erste Vorsitzende.
1992 etablierte sich die GEDOK Gruppe wieder in Leipzig unter der Leitung der Malerin und Grafikerin
Christl Blume-Benzler.
Oft nur als Muse von Max Klinger ist Elsa Asenijeff (1867-1941) bekannt geworden. Allerdings war sie um die Jahrhundertwende eine bekannte Schriftstellerin. Sie schrieb mehrere Bücher u. a. "Tagebuchblätter einer Emanzipierten", "Ist das Liebe", Novellen und veröffentlichte in Zeitungen und Zeitschriften. Mit Max Klinger lebte sie in wilder Ehe, er bekannte sich aber nie öffentlich zu dieser Beziehung. In ihren Büchern greift sie Themen, wie die sexuelle Unterdrückung der Frauen auf, oder die Unfähigkeit der Männer, Frauen auf geistiger Ebene als gleichberechtigte Partner zu begegnen. Elsa Asenieff wurde später als geistesgestört interniert und verbrachte zwei Jahrzehnte ihres Lebens in Irrenanstalten, obwohl es nie eine eindeutige Diagnose gab.
Lene Voigt (1891-1962) wird heute als sächsische Nationalschriftstellerin verehrt. Sie lernte zuerst Kindergärtnerin in der Henriette-Goldschmidt-Schule und später Verlagskontoristin. Doch schnell veröffentlichte sie Gedichte in verschiedenen Zeitschriften. Das besondere daran: sie erschienen in der sächsischen Mundart. Mitte 1936 erhält sie ein Berufsverbot der Nazis. Angelastet wurde ihr eben die Benutzung der sächsischen Mundart und Kontakte zu linken Zeitschriften in der Weimarer Republik. Die folgende Bespitzelung hat sie zeitlebens nie richtig verarbeitet, sie wurde mehrmals in Nervenheilanstalten eingewiesen. Auch fehlte ihr die Anerkennung in der Öffentlichkeit. 1946 wird Lene Voigt von der Leipziger Vortragskünstlerin Fridel Hönisch wieder entdeckt, die seitdem Texte in ihr Programm aufnahm. Im gleichen Jahr wird Lene Voigt in die Universitäts-Nervenklinik Leipzig eingewiesen, in der sie später als Botin und in der Buchhaltung arbeitet, weil sie den Bereich des Krankenhauses nicht mehr verlassen wollte.
19. Jahrhundert
Louise Otto-Peters (1819-1895), Vorkämpferin und Begründerin der organisierten
deutschen Frauenbewegung, wirkte von 1860 bis zu ihrem Tode in Leipzig. Sie schrieb Beiträge
für verschiedene Zeitschriften wie den "Leuchtturm" oder "Die Gartenlaube". Sie gab für
diese Zeit ungewöhnlich brisant politischen Äußerungen bekannt u. a. die Forderung
nach Verbesserung der Mädchenerziehung. Von 1849-1852 erschien ihre "Frauen-Zeitung", die
erste langlebigere, politische deutsche Frauenzeitung. Ihre Zeitung unterstützte demokratische
Frauenaktivitäten und berichtete auch vom Leben der Arbeiterinnen, Dienstmädchen sowie
der Lage von politischen Gefangenen. 1865 gründete sie mit gleichgesinnten Frauen, wie
Auguste Schmidt, Ottilie von Steyber und Henriette Goldschmidt den Frauenfortbildungsverein Leipzig.
Wenige Zeit später am 18.10.1865 entstand daraus der Allgemeine Deutsche Frauenverein (ADF),
der die Frauenbewegung überregional verband und das Prinzip der Selbstorganisation von
Frauen verwirklichte.
1993 gründete sich in Leipzig die Louise Otto-Peters Gesellschaft, die mit zahlreichen
Veranstaltungen an das Wirken und Gedenken von Louise Otto-Peters erinnern möchte.
Eine weitere Mitbegründerin des ADF war Henriette Goldschmidt (1825-1920). Sie zog 1858 nach Leipzig und war über 40 Jahre lang Streiterin für die Rechte der Frauen in Deutschland. Ein weiteres Wirkungsfeld war ihr Engagement in der humanistischen Menschenerziehung Friedrich Fröbels. Ihre Forderungen nach Bildung für Frauen und Mädchen beförderte die Kindergartenerziehung in Leipzig. 1911 ermöglichte ihr eine Schenkung die Eröffnung einer Hochschule für Frauen in Leipzig. Damit hatte sie Bildungseinrichtungen für Mädchen und Frauen vom Kindergarten bis hin zur Universität geschaffen.
Auguste Schmidt (1833-1902) war ein hervorragende Pädagogin und Frauenrechtlerin. Sie war Vorsteherin des Steyberschen Institutes in Leipzig, Mitbegründerin des Leipziger Frauenbildungsvereines, Mitbegründerin und langjährige 2. und 1. Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins ADF, Mitherausgeberin und Autorin der "Neuen Bahnen", Mitbegründerin und Ehrenvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereines, Vorsitzende des Bundes deutscher Frauenvereine BDF. Sie war somit Vorkämpferin der bürgerlichen Frauen.
18. Jahrhundert
Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts entstanden in Leipzig Kaffeeschankstuben. Obwohl es Frauen untersagt war, diese Stuben zu betreten, geschweige denn, ein Gewerbe zu betreiben, gab es doch Frauen, die sich als Kaffeewirtinnen eintrugen. Die Bekannteste in Leipzig ist wohl die Lehmannsche Witwe, die 23 Jahre den Kaffeebaum führte. Ein knappes Dutzend meldete in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts einen Kaffeeausschank an. Es gab sogar eine Kaffeewirtin, die darauf bestand alle männlichen Formen des Anmeldeformulars durch weibliche zu ersetzen!!
Als zweite Frau von Johann Sebastian Bach ist Anna Magdalena Bach (1701-1760) bekannt geworden. Sie war eine talentierte Sängerin, bereits 1718 am Anhalt-Zerbster Hof angestellt, zwei Jahre später an der Köthener Residenz. Mit dem Umzug nach Leipzig und ihrer Heirat musste sie ihre Berufstätigkeit aufgeben und widmete sich den familiären Aufgaben. Sie gebar zwischen 1723 und 1742 dreizehn Kinder. Nach dem Tod Bachs lebte sie mit ihren Kinder in Armut bis zu ihrem Tod.
Oft mit Leipzig verbunden wird Luise Adelgunde Victorie Kulmus (1713-1762) später bekannt als die Gottschedin. Die Danzigerin heiratete Gottsched 1735 und zog anschließend nach Leipzig. Frau Gottsched war überaus gelehrt, sie besaß Kenntnisse in Latein und Kompositionslehre, schrieb Kantaten und Komödien. Außerdem unterstützte sie ihren Mann im großen Maße bei der Verbreitung der frühaufklärerischen Moral und Philosophie. Sie war seine Sekretärin und Assistentin. Weiterhin übersetzte sie aus dem Französischen und Englischen. Gemeinsam betrieben sie literarische Studien. Sie setzte sich für die Bildung von Mädchen und Frauen ein, auch wenn sie die Aufgabe der Frau in der Ehe und der Familie sah.
Als schreibende Frau zog Adelgunde Gottsched aber auch den Spott der Männerwelt auf sich,
genau wie drei andere Frauen die in Leipzig lebten.
Anna Helena Volckmann geb. Wolffermann (1695- nach 1768), Christiana Mariana von Ziegler geb.
Romanus (1695- 1760) und Friederike Caroline Neuber geb. Weißenborn (1697-1760).
Anna Volckmann schrieb und veröffentlichte Gedichte, litt aber zeitlebens an ihrer
mangelnden Ausbildung.
Friederike Caroline Neuber schloss mit Gottsched ein künstlerisches Bündnis und
wirkte bei der Erneuerung der deutschen Schauspielkunst mit. Nach dem Bruch mit Gottsched
förderte sie weiter junge Bühnendramatiker und schrieb Theaterstücke.
Mariana von Ziegler stammt aus einem wohlhabenden Elternhaus und genoss eine sehr gute
Ausbildung. Aufgrund ihrer Stellung konnte sie auch als Witwe einem Haushalt vorstehen und
führte in ihrem Haus einen literarisch-musikalischen Salon. Sie verfasste selbst drei
Bücher, in der sie Frauen darauf hinwies, neben ihren Haushaltspflichten, die eigene
Bildung nicht zu vergessen. 1731 wurde Mariana von Ziegler als erste Frau Mitglied in der
Deutschen Gesellschaft und bekam 1733 den Titel "Kaiserlich gekrönte Poetin" durch die
Universität Wittenberg verliehen. Diese Ehrung brachte ihr allerdings wiederum den Spott
der Studenten ein.
16./17. Jahrhundert
Im Zuge der Pietismus-Bewegung wurden durch einen Streit zwischen der Universität Leipzig und der Stadt Kollegien über die Bibelauslegung in Bürgerräume verlegt. Dieses ermöglichte auch Bürgerinnen an Bibelstunden teilzunehmen. Fünf Leipzigerinnen, "drei Jungfern Schubart (...) und noch zwei andere(n)" (S. 79) gelang es, sich Zugang zu diesen Räumen zu verschaffen. Somit fanden diese Frauen einen Weg zu Bildungseinrichtungen, der allerdings kurze Zeit später wieder verschlossen wurde. Weiterhin hielten die Leipzigerinnen im Haus der Katharina May in der Barfüßergasse eigene Konventikel ab.
14. Jahrhundert
Auch in Leipzig gab es im 14. Jahrhundert ein Beginenhaus. Das Beginentum war eine gesamteuropäische Bewegung, vor allem in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und in Belgien, bei der sich ehelose Frauen zusammenfanden. Anfangs auch von adligen Frauen besucht, waren es später vor allem Frauen aus dem Bürger- und Handwerkstand und mittelose Frauen. Die Organisation war weniger hierarchisch. Es musste kein lebenslanges Gelübde abgelegt werden, somit war der Austritt jederzeit möglich. Das Besondere an diesem Ort ist, dass er einen für diese Zeit doch unabhängigen Raum für Frauen darstellte, da ehelose Frauen ansonsten schutzlos der Gesellschaft gegenüberstanden.
Nachzulesen in "Leipziger Frauengeschichten. Ein historischer Stadtrundgang."
Herausgeberinnen Gerlinde Kämmerer und Anett Pilz im KuKuC e.V.